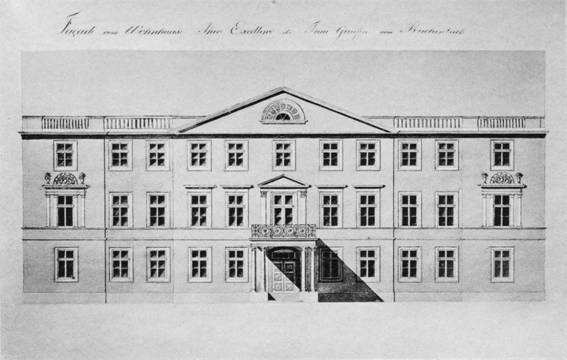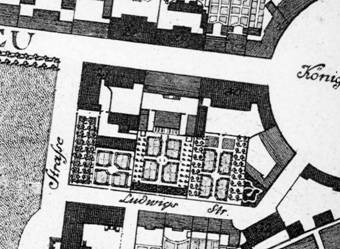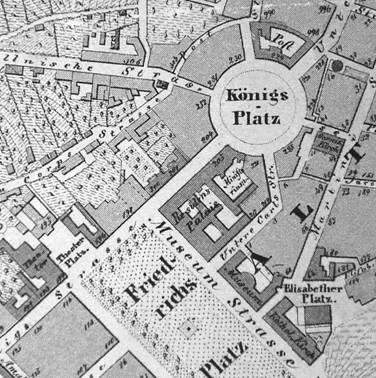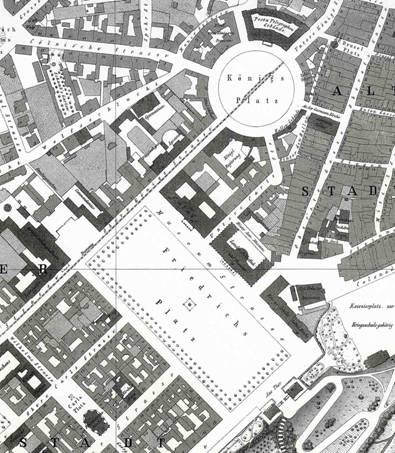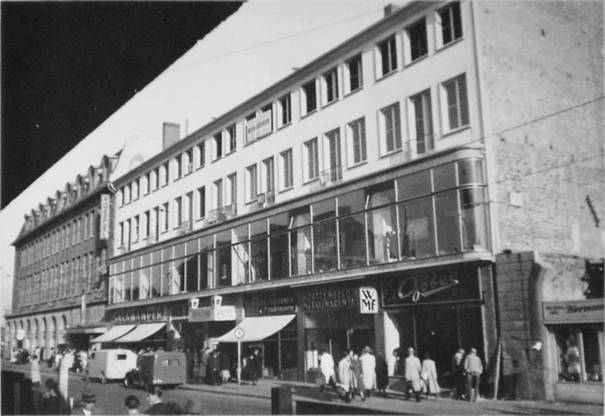Das Palais Reichenbach:
Die letzten größeren Reste des Kasseler Residenzpalais
werden im Sommer 2006 abgebrochen,
oder:
Quod non fecerunt ignes,
fecerunt investores.
Entwurf für den Umbau des Palais Gohr
zum Palais Reichenbach;
Johann Conrad Bromeis um 1821
(Holtmeyer,
Tafel 295,1)
|
Blick vom Königsplatz, um 1910; links das ehem. kurhessische
Staatsministerium (Holtmeyer,
Tafel 258,1, Ausschnitt) |
Blick vom Friedrichsplatz, um 1910; rechts das Weiße Palais (Holtmeyer,
Tafel 264, Ausschnitt) |
Geschichte:
Bis zum Juli 2006 war zwischen Oberer
Königsstraße und Unterer Karlsstraße eine geschichtliche und
architektonische Kostbarkeit der Kasseler Innenstadt erhalten: Trotz aller
Zerstörungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg standen hier die
letzten größeren Teile des kurfürstlichen Residenzpalais, die
letzten Zeugnisse dafür, daß Kassel einst hessische Hauptstadt war.
Der gesamte Komplex des Residenzpalais,
der seit 1816 ausgebaut und erweitert wurde, bestand aus mehreren Bauten: Am
Friedrichsplatz Weißes und Rotes Palais, die bereits um 1954 bis auf den
Portikus des Roten Palais abgebrochen worden sind; angrenzend in der Unteren
Karlsstraße ein Nebengebäude, sowie in der Oberen
Königsstraße ein Palais von ca. 1770; dieses war um 1821 von
Kurfürst Wilhelm II. erworben und nach umfangreichen Veränderungen
seiner Geliebten, der Gräfin Reichenbach, zur Verfügung gestellt
worden. Um dieses Palais handelt es sich nun.
Stadtplan von 1781 (Ausschnitt):
Zwischen Friedrichsplatz und
Königsplatz liegen das Palais der hessischen Landstände (27),
das Gohrsche Haus und das Palais der
Landgrafen von Hessen-Rotenburg (30)
(Holtmeyer,
Tafel 15)
Stadtplan um 1860 (Ausschnitt):
Weißes und Rotes Palais, Kleines
Palais (ehem. Palais Reichenbach)
und das Nebengebäude an der Unteren Carlsstraße sind als
Residenzpalais zusammengefaßt,
in Richtung zum Königsplatz grenzt das Ministerium an
Die Gräfin gehört zu den
umstrittensten Personen der kurhessischen Geschichte, ähnlich wie Lola
Montez in Bayern. Der Hof war in Anhänger der Kurfürstin und der
Gräfin gespalten, die Bevölkerung stand auf Seiten der
Kurfürstin; Proteste gegen die Gräfin fanden vor ihrem Palais in der
Königsstraße statt, das politische Klima wurde mehr und mehr
vergiftet; Höhepunkte waren die Unterstellung, die Gräfin habe
versuchen lassen, den Kurprinzen zu vergiften – in Wahrheit lediglich der
Selbstmord eines Lakaien –, die zeitweise Verbannung des Kurprinzen nach
Marburg, sowie Drohbriefe gegen den Kurfürsten und die Gräfin,
worüber selbst eine Pariser Zeitung berichtete. Wilhelm II. war zwar um
ein gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung bemüht, und so wurde
1830/31 auch die fortschrittlichste Verfassung verabschiedet, die es damals in
einem deutschen Staat gab. Doch wegen der starken Ablehnung der Gräfin
Reichenbach im Volk, wegen dieser Einmischung in sein Privatleben und den
Folgen für die Politik zog sich der Kurfürst 1831 mit ihr resigniert
nach Hanau zurück; der dramatische Stoff würde sich gewiß
für ein Drehbuch eignen: Sieg der Liebe über die Staatsraison.
Deutlich wird hier aber vor allem der Einfluß, den das Volk inzwischen
gewonnen hatte - daß ein Regieren gegen die Stimmung des Volkes nur noch
schwer möglich war.
Nach seiner faktischen Abdankung setzte
Wilhelm II. seinen Sohn Friedrich Wilhelm als Mitregenten ein; das Palais
Reichenbach wurde Wohnsitz von dessen Ehefrau Gertrud, Gräfin von
Schaumburg und Fürstin von Hanau; die Bezeichnung lautete nun
„Kleines Palais“ (ab 1843), oder auch „Palais Hanau“.
In Stadtplänen jener Zeit wird der gesamte Gebäudekomplex als
Residenzpalais bezeichnet, im Inneren waren alle Gebäude miteinander
verbunden.
Luftbild, 1929:
vorne Weißes und Rotes Palais,
dahinter Palais Reichenbach (mit hellem Seitenflügel)
und die Nebengebäude an der Unteren Karlsstraße (ebenfalls mit
hellem Seitenflügel)
(Brier
/ Dettmar, S. 176/177)
Luftbild:
im Vordergrund die Untere
Karlsstraße, links oben das Weiße Palais, daneben das Palais
Reichenbach
(Brier
/ Dettmar, S. 164)
Nach der Annexion durch Preußen 1866 wurde
das Kleine Palais zunächst funktionslos, und 1870 mauerte man die
Verbindungstüren zum Weißen Palais zu. 1881 wurde es
schließlich verkauft und dort das Palais-Restaurant
eingerichtet; Seidentapeten, Stuckdecken und Dekorationsmalereien erinnerten an
die fürstliche Vergangenheit. 1912 erfolgte nochmals ein Umbau zur
Gaststätte Zum Hackerbräu;
vermutlich in diesem Zusammenhang wurde auch die Fassade verändert. Die
beiden großen Hackerbräu-Säle wurden allerdings 1923 wieder
aufgegeben und anderweitig vermietet, das Restaurant nur noch bis zum Ablauf
des Pachtvertrags weiterbetrieben. In das Erdgeschoß und das
Obergeschoß der Nebengebäude zog dann die Billard-Akademie ein, in das 2. Obergeschoß das Herkulesbräu.
Beim Luftangriff am 8. Sept. 1941 wurde neben
Museum Fridericianum und Rotem Palais auch das ehem. Palais Reichenbach
getroffen und brannte aus. Der Wiederaufbau nach 1945 bezog die erhaltenen
Reste ein und lehnte sich an die frühere Situation an.
Stadtplan von 1877 (Ausschnitt):
Das Kleine Palais ist inzwischen aus dem
Gesamtkomplex des Residenzpalais herausgelöst.
Der nördliche Teil des
Seitenflügels gehörte ursprünglich zum Palais Hessen-Rotenburg;
dieses Gebäude an der Stelle der heutigen Commerzbank diente im
Kurfürstentum als Regierungssitz: Hier waren die Ministerien
untergebracht, von hier aus wurde Hessen regiert. Auch in preußischer
Zeit blieb es Regierungspräsidium, bis 1881 der Neubau an der Fulda
vollendet war.
Blick vom Weißen Palais in den Hof des
Palais Reichenbach nach dem Brand von 8.9.1941;
links das Treppenhaus, im Hintergrund der
Seitenflügel
(Stadtmuseum Kassel)
Der Wiederaufbau, 1948/49
(Stadtmuseum Kassel)
Im Hintergrund ist das halbrunde
Treppenhaus mit den inneren Bogenstellungen zu sehen, sowie eine angrenzende
Fensterachse; auf dem oberen Bild links die Brandmauer des
Commerzbankgebäudes, daneben die nördliche Außenmauer des ehem.
Seitenflügels des Palais Hessen-Rotenburg, des späteren kurhessischen
Staatsministeriums. Die Stützen und der Stahlträger an der
Königsstraße stammen vom letzten Umbau vor dem Zweiten Weltkrieg.
Unter Beibehaltung der verwendbaren Reste entstand an der
Königsstraße ein eingeschossiger Notbau für die Läden,
welche schon vor der Zerstörung hier ansässig waren. Im Hof sind auf
der oberen Aufnahme provisorische Bauten zu sehen, die das wiedereröffnete
Herkulesbräu aufnahmen (Hotel
und Gaststätte); sie bezogen vielleicht noch Reste der Billard-Akademie aus der Vorkriegszeit
ein. In einem nächsten
Bauabschnitt erfolgte der Aufbau von 3 Obergeschossen.
Der erste Notbau, im Sommer 1949
(Klaube,
S. 14)
Das Gebäude nach dem Wiederaufbau:
eine klassische Putzfassade der frühen
50er-Jahre,
mit großer Fensterfront im 1. OG und
kleinen Austritten im 2. OG
(Stadtmuseum Kassel)
Luftbild der Innenstadt, Anfang 1955:
In dem geringen Baubestand jener Zeit
fallen die Treppenstraße und die angrenzende Bebauung der Königsstraße
bis zum Königsplatz auf; im Hof des ehem. Palais Reichenbach erkennt man
die provisorischen Hotelbauten des Herkulesbräus. Später entstand hier die Königspassage mit dem Royal-Kino.
(Klaube,
S. 119)
Die Rückseite des zerstörten
Hauptgebäudes war nach den alten Vorgaben wiederaufgebaut worden, das
halbrunde Treppenhaus und das 1. Obergeschoß des Seitenflügels
blieben äußerlich unverändert erhalten; hinter den
Rundbogenfenstern im Seitenflügel hatte sich ursprünglich der
große Festsaal befunden – bis zum Abbruch 2006 der letzte erhaltene
Bau des bedeutenden Hofarchitekten Bromeis im Gebiet der Innenstadt.
Das Hauptgebäude mit seiner
schlichten, eleganten Fassade war das größte und
repräsentativste Beispiel für die Architektur der frühen
Wiederaufbauphase. In der Oberen Königsstraße zählen
hierzu außerdem das Haus Nr. 9, das Ensemble von Nr. 21 (Engel-Apotheke), 10 und 12, sowie die
Häuser Nr. 26 und 45a; Nr. 10 und 26 sind allerdings inzwischen leider mit
Platten verkleidet – eine Maßnahme, die um 1980 auch am Haus Obere
Königsstraße 30 erfolgte, die aber leicht reversibel gewesen
wäre.
Besonders sehenswert war auch das Innere
des Haupttreppenhauses – bis zum Abbruch die repräsentativste
Privathaustreppe der ganzen Königsstraße und eine bemerkenswerte
Schöpfung der Wiederaufbauzeit in Anlehnung an das
historische Vorbild, wobei auch die historischen Bogenstellungen einbezogen
waren.
So wurden im Jahre 2006 nicht nur die
letzten größeren Reste des kurfürstlichen Residenzpalais
abgebrochen, sondern auch ein bedeutendes Beispiel für die hohe
Qualität der frühen Wiederaufbauphase Kassels. Dies ist
umso bedauerlicher, da Kassel sich zwar rühmt, eine Stadt der 50er Jahre
zu sein, tatsächlich aber arm an größeren Wohn- und
Geschäftshäusern jener Zeit ist: Die meisten Bauten stehen entweder
noch in der Tradition nationalsozialistischen Siedlungsbaus (Altstadt) oder
entstammen jüngeren Stilphasen, so daß das Erscheinungsbild der
Innenstadt weitgehend von den 60er Jahren und noch jüngeren Bauten
geprägt ist.
In einer Liste der Baudenkmäler, die
am 28.12.1988 in der HNA durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
veröffentlicht wurde, war das gesamte Gebäude Königsstraße
30 als Kulturdenkmal aufgeführt. Diese Liste bildete einen
vorläufigen Ersatz für die fehlenden Bände der Denkmaltopographie
und ergänzte den bereits veröffentlichten 1. Band, in dem das
Gebäude noch nicht enthalten war.
(Die
nachfolgenden Photographien können durch Mausklick auf das Bild
vergrößert werden. In dem neuen Fenster erscheint beim Berühren
des Bildes ein Vergrößerungssymbol; durch erneutes Klicken auf
dieses Symbol kann das Bild weiter vergrößert bzw. wieder
verkleinert werden)
Blick aus der Straße Hinter dem
Museum auf die Gebäude, 2003:
Man erkennt das halbrunde Treppenhaus und
das Obergeschoß des Seitenflügels
Blick aus der ehem.
Gerhard-Hauptmann-Schule (Dock 4), 2003
Blick aus der Königspassage auf das
Obergeschoß des Seitenflügels, 2003
Blick aus der Königspassage auf das
Obergeschoß des Seitenflügels, 2003
Blick aus dem Treppenhaus auf den
Seitenflügel, 2003
Die Gliederung aus Rundbogenfenstern mit
einfachen Umrahmungen, Kämpfergesims und Archivolten war charakteristisch
für den Kasseler Klassizismus; in der Innenstadt war der Seitenflügel
des Palais Reichenbach das letzte Beispiel dafür.
Innentür im Treppenhaus, 2003
Aufgang zum 1. Obergeschoß, 2003
Aufgang zum 2. Obergeschoß, 2003
Blick vom 2. Zwischenpodest, 2003
Der Abbruch
Anfang 2003 wurden Absichten des
Düsseldorfer Investors BTV Development bekannt, an der Stelle der
Königspassage einen Neubau zu errichten. Die Planungen wurden (anscheinend
nach einem Wettbewerb) durch das Architekturbüro Bieling & Bieling in
Kassel erstellt.
Überlegungen, zumindest
Seitenflügel und Treppenhaus in den Galerie-artigen Neubau zu integrieren,
hat es anscheinend zu keiner Zeit gegeben. Dabei hätte hier die
Möglichkeit bestanden, sich durch eine historische Atmosphäre des
großen Lichthofes von den anderen, sehr ähnlichen Einkaufsgalerien
wohltuend abzusetzen und dies auch werbewirksam zu nutzen. (Man denke an die
Kurfürstengalerie, die sich auf das nahe Kurfürstengrab am
Altstädter Friedhof bezieht und kürzlich öffentlichkeitswirksam
die Rekonstruktion eines Denkmals für Kurfürst Wilhelm I. in der
großen Halle aufstellen ließ.) - Ein Brief des Arbeitskreises
für Denkmalschutz und Stadtgestalt an den Investor, in dem auf diese
Chance hingewiesen wurde, blieb ebenso unbeantwortet, wie ein weiteres
Schreiben an das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Marburg (beide
datiert vom 12.7.2003).
Aus den wenigen Zeitungsmeldungen kann
bislang nur folgender Ablauf rekonstruiert werden:
Der Investor stellte eine Bauvoranfrage bei
der Stadt Kassel, ob das Gebäude abgebrochen werden kann. Diese Anfrage
wurde routinemäßig an die Untere Denkmalschutzbehörde
weitergeleitet. Die Antwort lautete auf Freigabe: „Es handele sich eindeutig um an den Originalen orientierte
Bauten der Fünfzigerjahre (also Kopien!), die nicht als Denkmale
eingestuft seien. Die Denkmalschutzbehörde habe aus diesen Gründen
keinerlei Einwände gegen einen Abriss im Rahmen der Neugestaltung des
Komplexes erhoben“ (Aussage des damaligen Stadtbaurates Bernd Streitberger,
HNA vom 10.9.2003).
Im September befaßte sich dann
nachträglich der Denkmalbeirat der Stadt Kassel mit dem Palais
Reichenbach, der an dieser wichtigen Entscheidung nicht beteiligt worden war;
er verabschiedete einstimmig eine Resolution, in welcher der Erhalt der
baulichen Reste des Palais Reichenbach gefordert wurde. Die Resolution wurde
per Beschluß an die Presse gegeben, was bemerkenswert genug ist –
aus diesem Grund darf auch daraus zitiert werden:
„Der
Denkmalbeirat der Stadt Kassel ist erschüttert, dass bei der Neubauplanung
des Kaufhauses an der Oberen Königsstraße 30 die baulichen Reste des
ehemaligen Palais Reichenbach in keiner Weise Berücksichtigung finden [...]. Eine für den Investoren- und Architektenwettbewerb
bereits im Voraus ohne Anhörung des Denkmalbeirats ausgesprochene
Zusicherung einer Abbruchgenehmigung durch die Stadt Kassel führt
jegliches Bemühen um die Sicherung bedeutender Zeugnisse der Stadt- und
Stadtbaugeschichte ad absurdum.
Dem
Denkmalbeirat ist mit dieser sich wiederholenden Verfahrensweise die
Arbeitsgrundlage entzogen.
In
Ausübung des vom Magistrat der Stadt Kassel legitimierten Auftrags fordert
der Denkmalbeirat den Magistrat der Stadt Kassel auf:
Die
Ausloberverfahren und planerischen Festsetzungen vor Planungsbeginn mit dem
Denkmalbeirat abzustimmen und keine vorhergehenden Abstimmungen und Zusagen
ohne dessen Zustimmung an bestimmte Architekten- oder Investorengruppen zu
erteilen.
Der Denkmalbeirat
empfiehlt als beratendes Gremium der Unteren Denkmalschutzbehörde:
1
Einspruch gegen die Abbruchgenehmigung zu
erheben bzw. die Abbruchgenehmigung nicht zu erteilen.
2
Einforderung einer baulichen Lösung
unter Einbeziehung der Reste des ehemaligen Palais Reichenbach [...].
3
Überprüfung der gesamten
Höhenentwicklung der Fassade zur Oberen Königsstraße [...].“
Einen weiteren Versuch zur Rettung des
Gebäudes unternahm Ende 2003 der Verein für Hessische
Geschichte und Landeskunde, indem er sich an das Landesamt für
Denkmalpflege in Wiesbaden wandte, unter Berufung auf die 1988 öffentlich
bekanntgegebene Denkmaleigenschaft (Schreiben vom 30.11.2003); Grundlage
bildeten zwei Artikel im Erlaß zur Durchführung des
Denkmalschutzgesetzes vom 5. September 1986, Erlaß vom 21. Mai 1996:
Abs.
4: Gegebenenfalls bitte ich, das Landesamt für Denkmalpflege rechtzeitig
einzuschalten, damit in Zweifelsfällen die Kulturdenkmaleigenschaft eines
Objektes rechtzeitig beurteilt werden kann. (Dies wäre angesichts der
Aufnahme in die Liste der Kulturdenkmäler 1988 und angesichts der
augenscheinlich historischen Architekturteile des Seitenflügels geboten
gewesen.)
Abs.
5: Die untere Denkmalschutzbehörde gibt daher dem Landesamt für
Denkmalpflege Hessen von allen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes
beabsichtigten Entscheidungen Kenntnis und muß das ausdrückliche
Einvernehmen des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen einholen. Dies gilt
insbesondere für Genehmigungen nach §16 HdSchG [...]. (Es wurde seitens der Stadt die
Abbruchgenehmigung für ein eingetragenes Kulturdenkmal zugesagt,
offenkundig ohne Rücksprache mit dem LafDH.)
Eine Antwort erfolgte nicht.
Anfang 2005 wurde der Bauantrag
einschließlich der Abbruchgenehmigung gestellt und positiv beschieden.
Der verantwortliche Architekt, Prof. Thomas Bieling, hatte eine Einbeziehung
der historischen Teile in seinen Entwurf abgelehnt.
Das Areal einschließlich der fertigen
Planungen ist zur Zeit des Abbruchs vom Düsseldorfer Investor bereits an
den Hamburger Endinvestor DIFA (Deutsche Immobilienfonds AG) weiterveräußert.
Beim Abbruch war ein letztes Mal die
Baugeschichte des Areals zu erkennen:

Entwurf des Neubaus
(Bieling & Bieling / Development
Partner AG)
Auf der Internetseite
des planenden Investors heißt es dazu: „Den neuen Mietern stellt die DEVELOPMENT PARTNER AG moderne und
großzügige Büro- und Einzelhandelsflächen in einem
architektonisch hochwertigen und auf den Standort bezogenen Geschäftshaus
zur Verfügung. Für die Kasseler Innenstadt bedeutet die Realisierung
dieses Vorhabens eine klare Aufwertung des Stadtbildes an der Oberen
Königstraße. “
Die Fertigstellung erfolgte Ende 2007.
Bildnachweis und Literatur:
Bildlingmaier,
Rolf: Das Residenzpalais in Kassel, hg. von Friedl Brunckhorst (Studien zum
Kulturerbe in Hessen 1), Regensburg 2000.
Brier, Helmut / Werner Dettmar: Kassel. Veränderungen
einer Stadt I, Fuldabrück
1986.
Holtmeyer, Alois: Die Bau- und
Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, Bd. VI, Kreis Cassel-Stadt, 5
Bde., Marburg 1923.
Hermsdorff, Wolfgang: Vom Palais zum
bürgerlichen Lokal (Ein Blick zurück 528), HN vom 24.2.1973.
Klaube, Frank-Roland: Kassel lebt.
Neubeginn aus Trümmern, Gudensberg-Gleichen 1990.
Wichtige
Zeitungsartikel:
Amtliche
Bekanntmachungen der Stadt Kassel. Durchführung des Denkmalschutzgesetzes,
Teil 1, HNA vom 28.12.1988.
Neubau
rückt näher, HNA vom 27.6.2003.
Abriss scheint
unvermeidbar, HNA vom 10.9.2003.
Denkmalbeirat
fordert Erhalt der Palais-Reste, HNA vom 24.9.2003.
Geschäftshaus
ist bald weg / Hintergrund, HNA vom 4.9.2006.