Rundgang durch die Zeremonialräume des Roten Palais
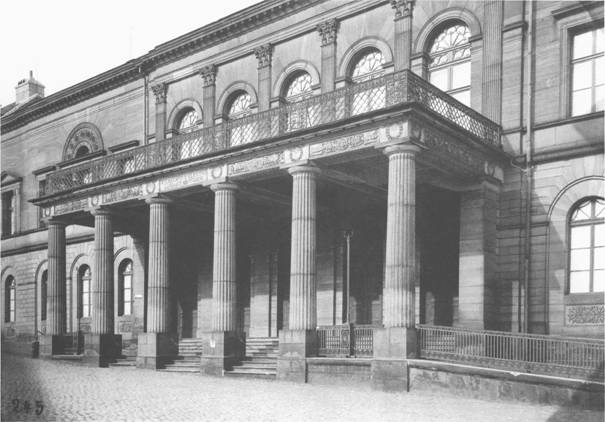
Ansicht um 1910
(Bidlingmaier, S. 124)
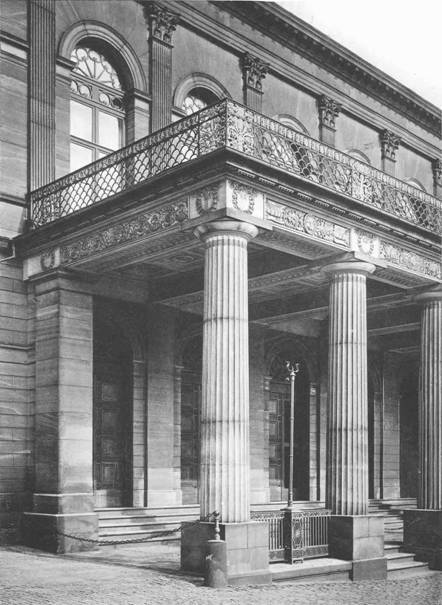
Portikus mit Haupteingang, um 1922
(Holtmeyer,
Tafel 267)
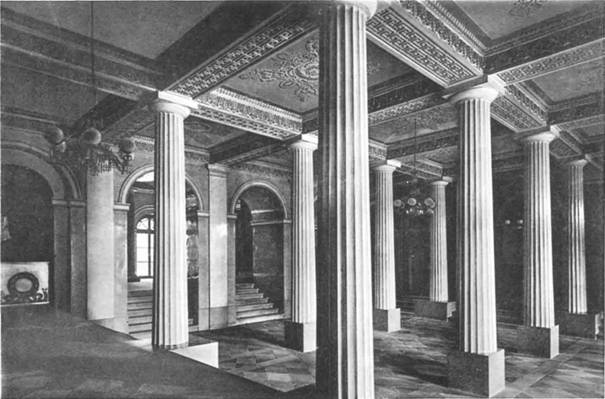
Vestibül des Roten Palais, hinter dem
Portikus, um 1922
(Holtmeyer,
Tafel 270,1)
Fußboden aus rotem und weißem Sandstein,
Wände in hellgrauem Stuckmarmor, Säulen in weißgrauem Stuckmarmor, Decke
mattgelb, bemalt.

Treppenhaus des Roten Palais, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 269)
Fußboden aus weißem und blaugrauem Marmor,
die Wände in grünen (OG) Stuckmarmor, die architektonische Gliederung in gelbem
Stuckmarmor mit weißen Einzelteilen, die Sockel rotbraun. Die Felder der Decken
grau mit weißer Malerei, die Gurtbögen (OG) rosa, mit weißen Stuckleisten und
weißer Malerei. Geländer blau mit vergoldeten Ornamenten. Im Blickpunkt eine
große Glastür zum Aufwartungszimmer, das Bogenfeld verspiegelt. Die Statuen
waren Gipsabgüsse antiker Originale (Paris, Venus mit Muschel, eine Muse, ein
einschenkener Satyr, Bacchus / ein Hirtenknabe, ein betender Knabe, Venus,
Minerva, ein Fechter). Die Treppenstufen bestanden aus weißem, gelblichem
Sandstein. Die Länge betrug im Erdgeschoß etwa 23m, die Gesamthöhe ca. 12m.
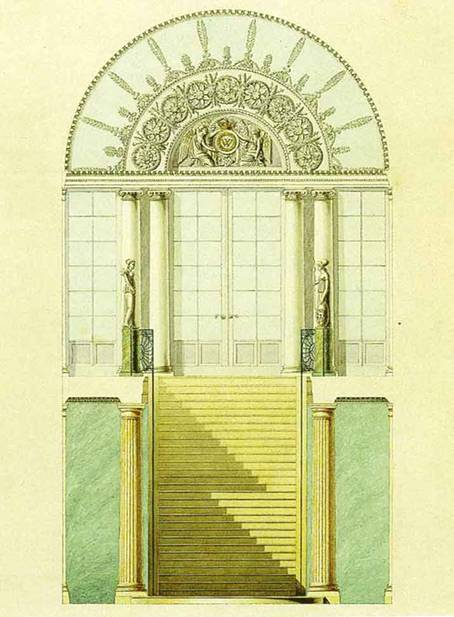
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf, um 1923
(Bidlingmaier,
S. 206)
Durch die Glastür sichtbar war das
Aufwartungszimmer:

Das Aufwartungszimmer, 1932
(Bidlingmaier,
S. 216)
Der Blick auf der Photographie geht durch
die Türen zum Treppenhaus; 1928-38 diente das Aufwartungszimmer als Fahnensaal
mit Fahnen der hurhessischen Armee.
Die Wände waren mit einer grünlich
marmorierten Boiserie bekleidet, Pilaster und Gesims hell marmoriert, Leisten,
Basen, Kapitelle und Archivolten weiß gestrichen. Die Kassetten der Decke waren
weiß auf gelben Grund gemalt. In der Nische links im Bild stand hinter dem
Gitter ein Ofen. Der Fußboden war einfaches Tafelparkett.
Ab dem Aufwartungszimmer steigerte sich nun
die Ausstattung der Räume, was u. a. an den Fußböden und den Türen erkennbar
ist.

Kleine Galerie, 1932
(Bidlingmaier,
S. 221)
Die Kleine Galerie (Pompejanische Galerie,
Rosakabinett) grenzte in Richtung zum Friedrichsplatz an: Die Wände waren mit
rosafarbenem Stuckmarmor bekleidet, Gesimse, Pilasterbasen und –kapitelle weiß.
Die Decke mit bunten Malereien geschmückt, in den seitlichen Bogenfeldern
Ölgemälde (Zug der Juno und Geburt der Venus). Der Intarsienfußboden bestand
aus Ahorn, Mahagoni und (in der Rosette) Kirsche, die Türen aus Mahagoni mit
vergoldeten Beschlägen.

Blauer Empfangssaal, 1910
(Bidlingmaier,
S. 228)
Durch das Aufwartungszimmer und eine kleine
Verbindungsgalerie gelangte man in den Blauen Empfangssaal: tiefblaue,
golddurchwirkte Seidentapeten, der Stuckmarmor der Lambris (Sockelzone) und im
Hintergrund der Nischenlünette (Bogenfeld) grau, an den Pilastern (flachen
Wandsäulen) rosa, sonst weiß. Decke überwiegend auf hellblauem bzw. blauem
Grund, Intarsienfußboden aus Mahagoni, Ahorn und Kirsche, Türen und Möbel aus
Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. In der Nische verdeckten blau lackierte
Kupferplatten mit vergoldeten Ornamenten den Ofen.
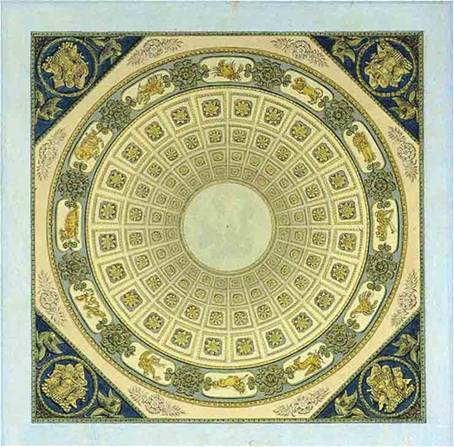
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Decke des Blauen
Empfangssaals, um 1824
(Bidlingmaier,
S. 223)
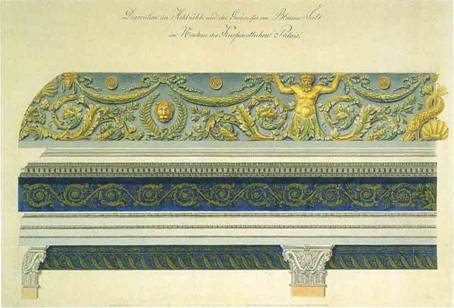
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für Hauptgesims und Voute im Blauen
Empfangssaal, 1827
(Bidlingmaier,
S. 224)
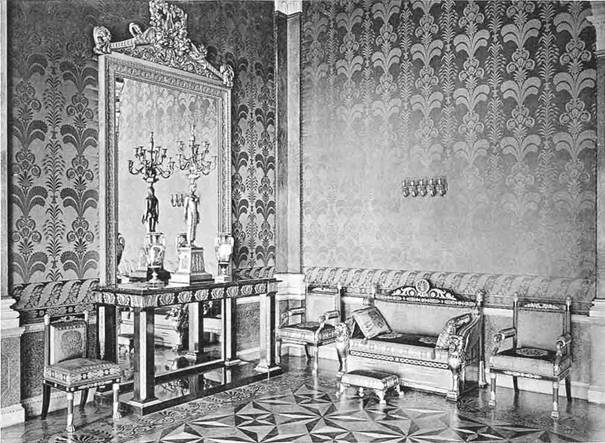
Ecke im Blauen Empfangssaal, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 285)
Der nächste Empfangssaal war zugleich der
größte Saal in der Raumfolge zum Friedrichsplatz, hinter den großen
Fenstertüren zum Altan gelegen:

Grüner Empfangssaal, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 283)
Namensgebend war die vorherrschende Farbe:
Den Raumeindruck bestimmten grüne, golddurchwirkte Seidentapeten, außerdem
waren Lambris, Ofennischen und Rücklagen der Pilaster aus ebenfalls grünem, die
übrige Architekturgliederung aus gelbem Stuckmarmor. Der Sockel rotbraun, die
Abschlußleiste der Lambris vergoldet. Die Decke weiß und grünlich, mit
bronzefarbenen, gemalten Ornamenten. Der Fußboden ebenfalls aus Kirsche, Ahorn
und Mahagoni, die Türen und Möbel aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. Der
Saal maß etwa 17,8m * 12,1m, die Höhe betrug ca. 7,8m.

Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für das Hauptgesims, um 1827
(Bidlingmaier,
S. 236)
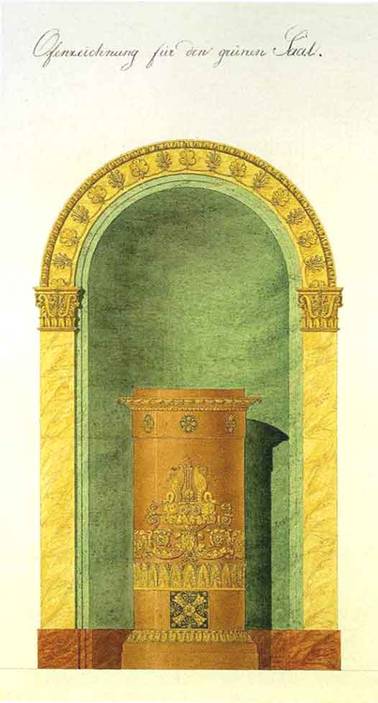
Justus Schnackenberg nach Bromeis:
Entwurf für eine Ofennische, um 1828
(Bidlingmaier,
S. 238)

Armstuhl aus dem Grünen Empfangssaal;
die Bespannung aus grünem Seidendamast ist
mit der Wandbespannung identisch
(Bidlingmaier,
S. 241)
Für die einzelnen Räume gab es im Hofzeremoniell
eine strenge hierarchische Abstufung; als Beispiel sei der Empfang
ausländischer Botschafter angeführt: Im Blauen Empfangssaal standen die
niederen Ränge des Hofstaates, und das Gefolge des Botschafters blieb hier
zurück. Der Botschafter wurde nun in den Grünen Empfangssaal weitergeleitet, wo
die oberen Hofchargen und die Diener versammelt waren. Der
Oberzeremonienmeister meldete nun die Ankunft des Botschafters und führte
diesen in den Thronsaal:

Der Thronsaal, 1932
(Bidlingmaier,
S. 250f.)

Der Thronsaal, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 281)
Der Thronsaal bildete den Höhepunkt der
Raumfolge und war in den hessischen Farben ausgestattet: weißer Stuckmarmor
(mit vergoldeten Ornamenten) und rote Samtbespannung. Der Fußboden aus Ahorn,
Kirsche, Birnbaum und Mahagoni, die Decke weiß, mit dunkelblauem Rahmen,
lachsfarbenen und hellblauen Feldern sowie bronzefarbenen Ornamenten. Die
Gemälde zeigten Jupiter (über dem Thron), Mars (gegenüber), Minerva (an der
Seite zum Friedrichsplatz) und Ceres (an der Seite zum Tanzsaal). Die Türen
wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten Ornamenten.
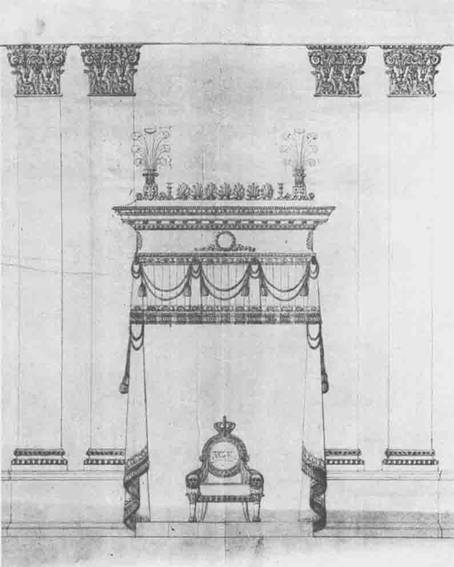
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für den Thronbaldachin, 1829
(Bidlingmaier,
S. 252)

Thron;
die rote Samtbespannung entspricht der
Wandbekleidung
(Bidlingmaier,
S. 254)
Durch die seitliche Tür im Thronsaal
gelangte man nun in den großen Tanzsaal, welcher aus der ersten
Erweiterungsphase des kurprinzlichen Palais stammte:

Der Tanzsaal, 1932
(Bidlingmaier,
S. 194f.)
Der Saal entstand zwischen 1817 und 1823 -
mit 26,60m Länge, 11,80m Breite und 8m Höhe der größte Saal des Residenzpalais,
in der Qualität seiner Ausstattung vielleicht der bedeutendste Saal des
Empirestils in Deutschland. Der Saal wurde von dem wirkungsvollen Farbkontrast
gelb (gold) / blau bestimmt: die Wandflächen in gelblichem Stuckmarmor,
Säulenschäfte und Fries in blauem Stuckmarmor (Lapislazuli-ähnlich) mit
vergoldeten Basen, Kapitellen und Ornamenten. Auch die Möbelbezüge und
Vorhänge waren in demselben Tiefblau gehalten, mit goldenen Sternen. Die Decke
hellblau grundiert, mit weißgrauen und bronzefarbenen Malereien auf blauem und
gelbem Grund. Die Sockelzone aus braunem Stuckmarmor leitete zum
Intarsienfußboden über, der aus Kirsche, Ahorn und Mahagoni bestand; die Türen und
Möbel wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. Der große Kronleuchter
in der Mitte hatte einen Durchmesser von fast 3m und wog 38 Zentner; insgesamt
konnte der Saal von mehr als 700 Kerzen erhellt werden.

Tanzsaal, Nordostecke, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 279)
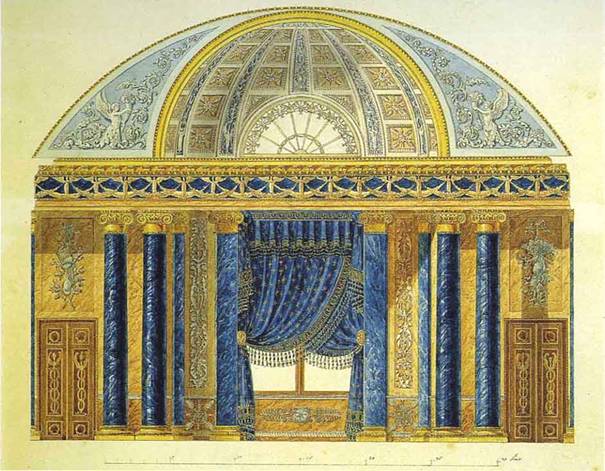
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Südseite des Tanzsaals, um
1819
(Bidlingmaier, S. 190)
Das Fenster wurde beim Anbau des Roten
Palais in eine Verbindungstür umgewandelt, das halbkreisförmige Fenster der darüber
befindlichen Musikerempore geschlossen. Der Treppenaufgang zur Empore befand
sich hinter der linken Tür.
Das Residenzpalais:
Weißes Palais, Rotes Palais und Palais Reichenbach
Rundgang
durch das Weiße Palais, Stuckgalerie, Tanzsaal, Speisegalerie und Pariser Saal
Geschichte
des Palais Reichenbach