Rundgang durch das Weiße Palais und einige Räume des
Roten Palais

Das Weiße Palais 1932
(Bidlingmaier,
S. 111)
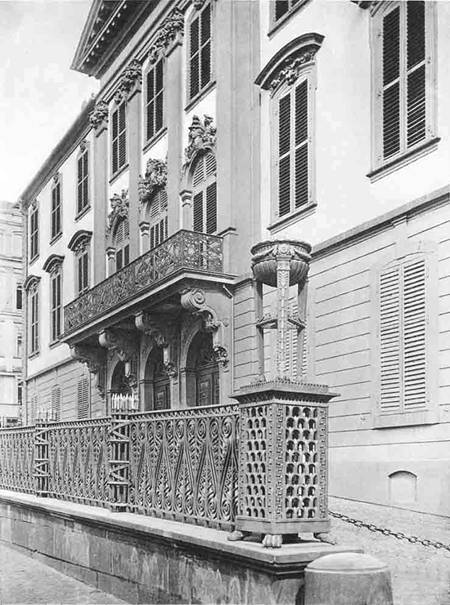
Rampe und Haupteingang, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 265)
Zum Zeitpunkt der Aufnahme war bereits der ursprüngliche
grünlich-weiße Anstrich verändert, indem Erdgeschoß und Architekturteile farbig
abgesetzt waren. Hinter den drei Eingangstüren befand sich das Vestibül mit
anschließender Hauptreppe:

Vestibül, um 1922
(Holtmeyer,
Tafel 270,1)
Die Wände braun marmoriert, die Decke weiß
gestrichen, der Fußboden aus roten und weißen Sandsteinplatten (die hessischen
Farben). Im Hintergrund sichtbar die Treppe aus Eichenholz; das Geländer aus
Birnbaumholz (Stäbe) und schwarz gebeiztem Kirschholz (Handlauf). Durch zwei
Glastüren erreichte man das Vorzimmer. Von diesem einfach ausgestatteten Raum
ging hofseitig in das Nebengebäude ein Kabinett ab, welches in die Gelbe
Galerie führte, im Hauptgebäude grenzten die Privaträume mit dem Schlafzimmer
an; an der Seite zum Friedrichsplatz folgte auf das Vorzimmer der ehem.
Festsaal des Gebäudes, der nun als Roter Saal eingerichtet war:
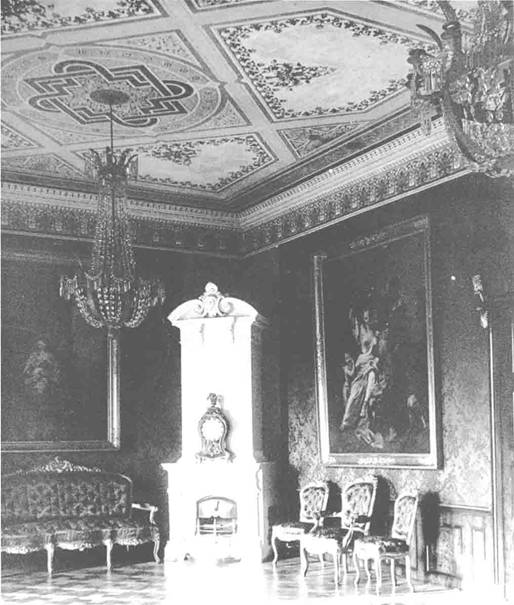
Roter Saal, um 1908
(Bidlingmaier,
S. 143)
Die Ausstattung des Roten Saales (Tapeten,
Fries, Deckenbemalung, Möbel) stammt weitgehend erst aus der Zeit um 1861.
Zuvor besaß der hinter dem Balkon gelegene Hauptsaal eine Bespannung aus
breitstreifigem roten Seidendamast und eine mit Rosetten bemalte und vergoldete
Decke.
Die Wandbespannung war roter Seidendamast,
Lambris und Türen bestanden aus Birken-, Kastanien- und Birnbaumholz, die
Konsolen der Türverdachungen waren vergoldet. Hinter den Öfen gelber
Stuckmarmor. Decke und Fries waren bunt bemalt.
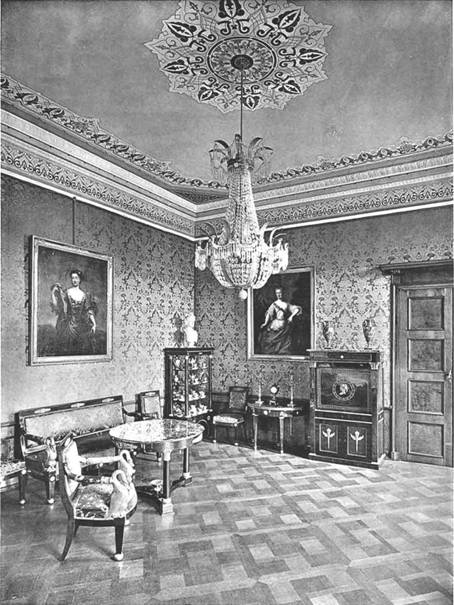
Gelbes Wohnzimmer, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 271)
Auch das Gelbe Wohnzimmer ist das Ergebnis
späterer Veränderungen, die hier um 1851 vorgenommen wurden. Namensgeben war
die gelbe Seidenbespannung der Wände, ebenso war die Decke gelb grundiert.
Lambris, Türen und Fensternischen aus Birnbaum, Birke (Füllungen) und Kastanie
(Rahmen). Fries und Decke bunt bemalt.
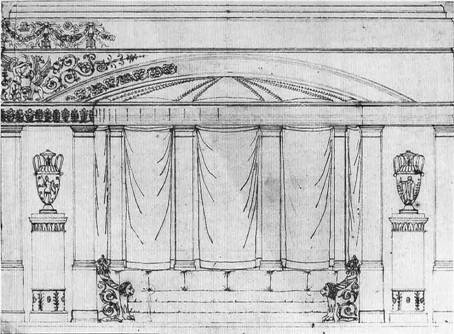
Johann Conrad Bromeis:
Entwurfsskizze für die Rückseite mit der
Nische, um 1815
(Bidlingmaier,
S. 146)
Ursprünglich befand sich an der Rückwand
eine Nische mit Pilastergliederung und Diwan, zwischen den Pilastern Draperien
aus blaugestreiftem Seidendamast, seitlich an der Rückwand Öfen. Beim Umbau
wurde die Nische geschlossen, Fries und Decke neu bemalt, die Öfen entfernt und
die Wandbespannung erneuert.

Holzkabinett, 1910
(Bidlingmaier,
S. 151)
Das Holzkabinett befand sich an der
Gebäudeecke zu Friedrichsplatz und Königsstraße; das platzseitige Fenster war
allerdings zugesetzt, und an der Innenseite befand sich hier ein Spiegel. Die
Wände, Türen und Fensternischen waren mit gemasertem Birkenholz in goldbraun
schimmernder Farbe vertäfelt, mit Einlagen aus Kastanien- und Pappelholz. Die
Säulen aus dunklem, polierten Erlenmaserholz, die Postamente aus Nußbaumholz.
Einzelne Ornamente (Säulenbasen und –kapitelle, Blattkränze, Friesornamente,
Spiegelumrahmung) waren weiß lackiert, die Ornamente am Kranzgesims vergoldet.
Der Fußboden aus hell und dunkel gebeiztem Ahornholz, die Decke im Mittelfeld
mit rosa Grund, in den Zwickeln mit blauem Grund.

Das Ägyptische Zimmer, 1910
(Bidlingmaier,
S. 162)
Dieses im deutschen Empire einzigartige
Zimmer war ganz im wirkungsvollen Farbkontrast Schwarz-Gelb/Gold gehalten: Die
Wandgliederung bestand vollständig aus schwarz gebeiztem und polierten
Birnbaumholz mit vergoldeten Ornamenten, Draperien und Möbelbezüge bestanden
aus gelbem Seidendamast mit schwarz/weiß gemusterten Borten, Schnüren und
Quasten. Verspiegelte Wandfelder, Türen und Supraporten sowie das verspiegelte
Mittelfeld der Decke mit den vergoldeten Ornamenten steigerten die Wirkung des
Raumes. Die bemalte Decke war ansonsten im mittleren Feld blau grundiert, im
Fries grün, mit gelber Einfassung, die Ornamente goldfarben und grün.
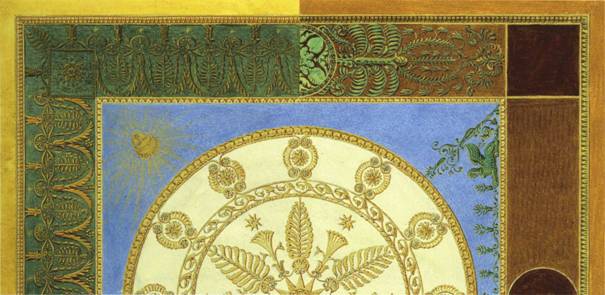
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Decke des Ägyptischen
Zimmers, um 1818;
für den umgebenden Fries wählte der
Kurprinz den linken Vorschlag, für das innere, blau grundierte Feld den rechten
Entwurf.
(Bidlingmaier, S. 160)
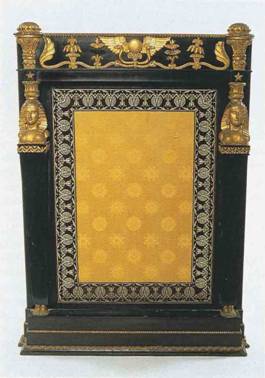
Ägyptisches Zimmer, Ofenschirm;
die Bespannung aus gelbem Seidendamast
entspricht den Draperien und Möbelbezügen
(Bidlingmaier,
S. 165)
Das Ägyptische Zimmer und der nachfolgende
Coursaal gehörten zur zweiten Umbauphase zum kurprinzlichen Palais, nachdem
zunächst die Wohn- und Gesellschaftsräume im Hauptgebäude begonnen worden
waren. Im Seitenflügel und den folgenden Anbauten wurden hauptsächlich
Repräsentationsräume geschaffen. Einen ersten Höhepunkt nach dem Ägyptischen
Zimmer bildete der Coursaal, der als Audienzsaal und ab 1821 bis zur
Fertigstellung des Roten Palais als Thronsaal diente:

Der Coursaal, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 276)
Rot war die vorherrschende Farbe des
Raumes, mit zahlreichen Vergoldungen: Türen, Supraporten, Lambris und
Fensternischen aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen, die Wandflächen mit
rotem, feuerfarbenem Seidendamast bespannt. Die Ofennischen mit rötlich-gelbem
Stuckmarmor bekleidet, die Archivolten blau und gold gestrichen, Kapitelle und
Kränze vergoldet. Die Pilaster neben den Türen aus Ahornholz mit vergoldeten
Basen und Kapitellen, das Hauptgesims blau grundiert, mit reichen Vergoldungen.
Die Decke war bunt bemalt, zur Mitte hin in helleren Farben.
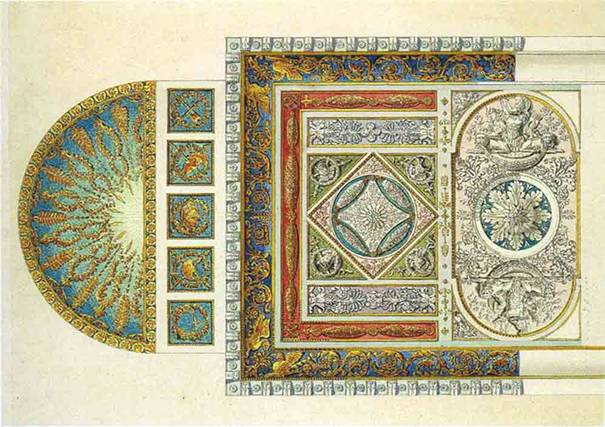
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Decke des Coursaals, um
1818
(Bidlingmaier,
S. 168)

Coursaal, Ofenschirm;
die Bespannung aus rotem Seidendamast
entspricht der Wandbespannung des Saals
(Bidlingmaier,
S. 173)
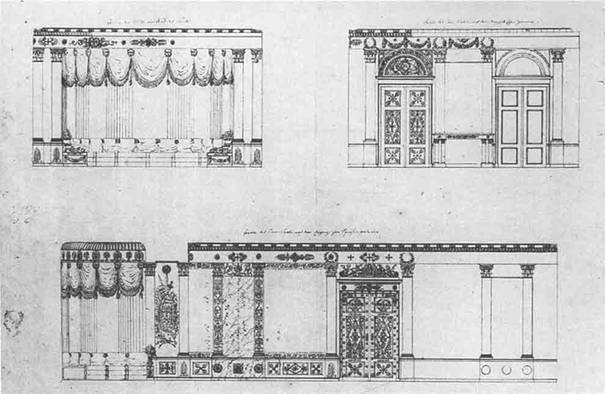
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für den Coursaal, um 1818
(Bidlingmaier,
S. 167)
An der nördlichen Stirnseite des Coursaals
befand sich ursprünglich eine halbrunde Nische, die 1842 entfernt wurde, dabei wurde
auch die Wandgliederung verändert, indem die Blindtür der Südseite als Tür an
die neue Nordwand versetzt und Spiegel und Konsoltisch entfernt wurden.
Aus dem Vorzimmer der Beletage gelangte man
hofseitig durch ein kleines Kabinett in eine zweite Folge von
Repräsentationsräumen: Zunächst in die Gelbe Galerie, von der keine
photographischen Abbildungen bekannt sind, und die ihren Namen nach der Farbe
ihrer Wandbespannung erhalten hatte; dann vermittelte ein kleines Kabinett in
die neuen Anbauten:
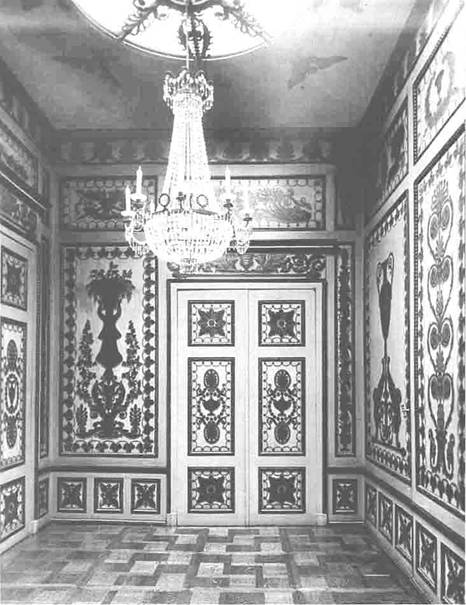
Oberlichtkabinett, um 1935
(Bidlingmaier,
S. 181)
Auf dem Bild fällt der Blick aus Richtung
der Stuckgalerie auf die Tür zur Dienertreppe; links führt eine Tür in die
Gelbe Galerie. Rechts ist in der Wandverkleidung eine weitere, nachträglich
eingebaute Tür verborgen, welche das Weiße Palais nach 1821 mit dem
angrenzenden Palais Reichenbach verband.
Die Wände waren mit einer gelblich
lackierten Boiserie verkleidet, mit grün-braunen Dekorationen. Der Fries hatte
einen rosafarbenen Hintergrund. Der Raum erhielt Tageslicht nur durch ein
rundes Oberlicht in der Decke.

Die Stuckgalerie, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 277)
Die Stuckgalerie diente neben der Gelben
Galerie zunächst als Speisesaal. Sie stellte zugleich die Verbindung zum
Tanzsaal her. Die Wände waren mit grünem Stuckmarmor überzogen, an der Lambris
etwas dunkler. Davon hoben sich die weißen Leisten der Lambris, der gelbe
Stuckmarmor der Pilaster und Archivolten sowie des Kämpfergesimses und
Hauptgesimses und die weißen Basen und Kapitelle ab. Die Decke war
hellblau-grau grundiert, mit weißem Stuck. Die Türen (zur Fensterseite jeweils
eine Blendtür) hatten einen Rahmen aus Kastanienholz, Leisten aus Mahagoni und
Füllungen aus Maserholz. Möbelbezüge und Vorhänge waren aus grüner Seide bzw.
grünem und gelbem Stoff, die Möbel aus Birkenmaserholz mit vergoldeten
Beschlägen.
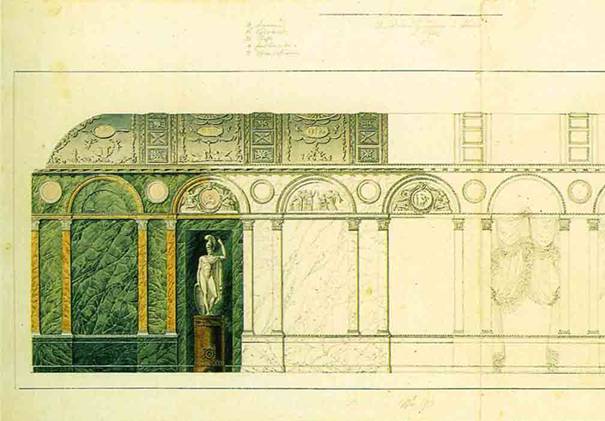
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Stuckgalerie, um 1818
(Ausschnitt)
(Bidlingmaier,
S. 182)
Den Höhepunkt der Raumfolge bildete der Tanzsaal:
mit insgesamt 26,60m Länge, 11,80m Breite und 8m Höhe der größte Saal des
Residenzpalais, in der Qualität seiner Ausstattung vielleicht der bedeutendste
Saal des Empirestils in Deutschland.

Der Tanzsaal, 1910
(Holtmeyer, Tafel 278)
Der Saal wurde von dem wirkungsvollen
Farbkontrast gelb (gold) / blau bestimmt: die Wandflächen in gelblichem
Stuckmarmor, Säulenschäfte und Fries in blauem Stuckmarmor
(Lapislazuli-ähnlich) mit vergoldeten Basen, Kapitellen und Ornamenten. Auch
die Möbelbezüge und Vorhänge waren in demselben Tiefblau gehalten, mit
goldenen Sternen. Die Decke hellblau grundiert, mit weißgrauen und
bronzefarbenen Malereien auf blauem und gelbem Grund. Die Sockelzone aus
braunem Stuckmarmor leitete zum Intarsienfußboden über, der aus Kirsche, Ahorn
und Mahagoni bestand; die Türen und Möbel wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten
Beschlägen. Der große Kronleuchter in der Mitte hatte einen Durchmesser von
fast 3m und wog 38 Zentner; insgesamt konnte der Saal von mehr als 700 Kerzen
erhellt werden.
Nach dem Anbau des Roten Palais mußte das
Fenster an der Südseite in eine Tür umgewandelt werden, welche den Saal mit dem
Thronsaal verband. Darüber befand sich die Musikerempore, deren
halbkreisförmiges Fenster dabei geschlossen wurde. Der Aufgang zur Empore
befand sich hinter der linken Tür.
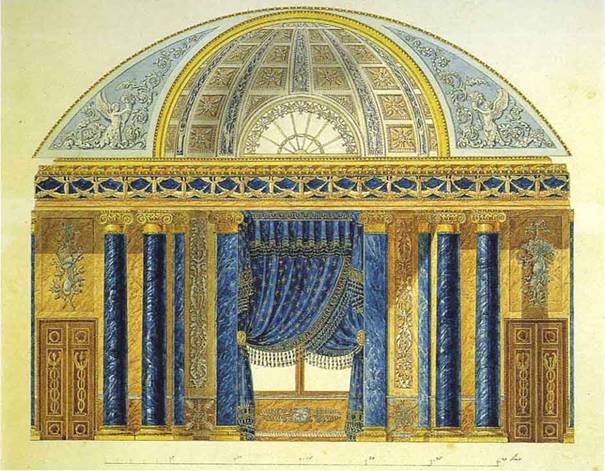
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Südseite des Tanzsaals, um
1819
(Bidlingmaier,
S. 191)
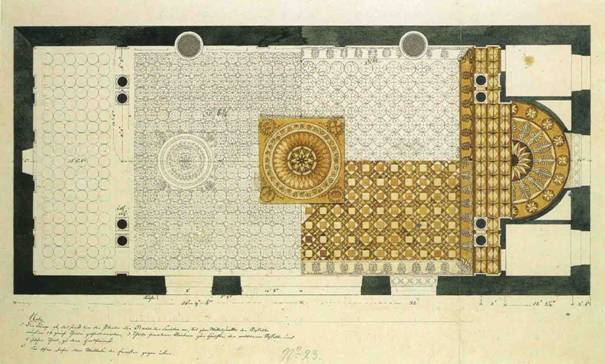
Johann Conrad Bromeis:
Entwürfe für den Fußboden des Tanzsaals,
1819;
der farbig angelegte Bereich wurde zur
Ausführung bestimmt
(Bidlingmaier.
S. 188)

Tür zur Speisegalerie, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 280)
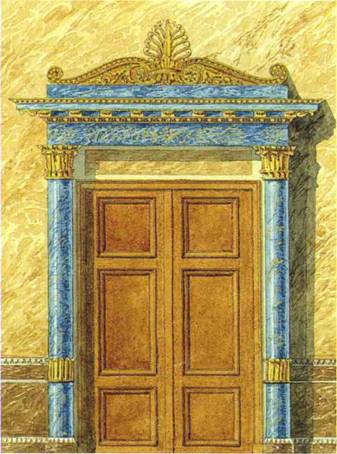
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für eine Tür im Tanzsaal, um 1818
(Bidlingmaier,
S. 190)
Vom Tanzsaal aus gelangte man weiter in die Speisegalerie, welche
bereits zum Roten Palais gehörte; darunter lag die Küche nebst einem Durchgang
in das benachbarte Nebengebäude in der Unteren Karlsstraße.
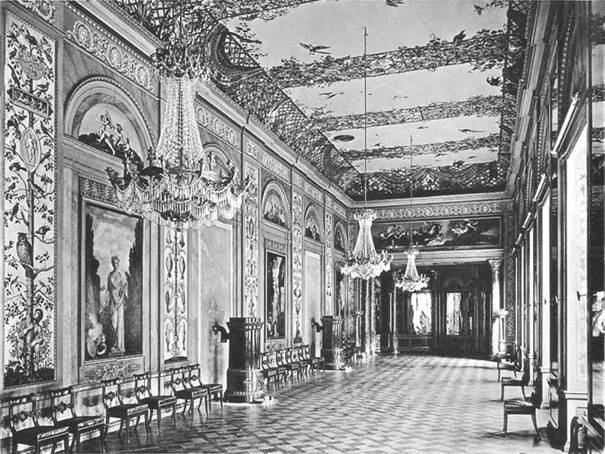
Die Speisegalerie, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 287)
Die Wände der Speisegalerie waren mit
bemalter Boiserie bekleidet und in Anlehnung an die italienische Renaissance
gestaltet: Die Boiserie (hinter den Öfen Stuckmarmor) war im Wesentlichen
grau-lila marmoriert, die Architekturteile gelblich marmoriert. An der Rückwand
wechselten drei Öfen mit den Vier Jahreszeiten von Adrain van der Werff ab (aus
den Beständen der Gemäldegalerie). Die Felder der Lisenen waren nach dem
Vorbild der Loggien Raffaels im Vatikan bemalt, an der Fensterseite mit
Spiegeln besetzt. Die Lünetten waren mit antikisierenden Szenen. Über der Tür
zum Tanzsaal Apollo mit dem Sonnenwagen nach Guido Reni, über der Büffetnische
die Meerfahrt der Galatea nach Raffael; die Nische mit Spiegeln besetzt. Die
Decke war in illusionistischer Manier als offener Himmel mit Rankenspalier,
Weinlaub, Draperien, Vögeln, Affen und anderen Tieren bemalt.
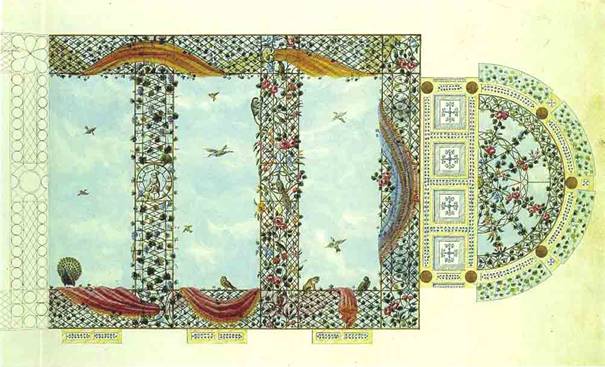
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Decke der Speisegalerie,
1828
(Bidlingmaier,
S. 270)
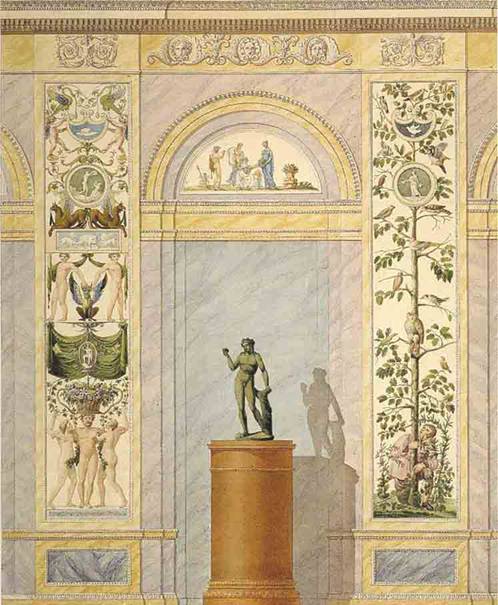
Johann Conrad Bromeis:
Entwurf für die Rückwand der Speisegalerie,
1828
(Bidlingmaier,
S. 271)
Bei Festen wurde der angrenzende Saal
zwischen Unterer Karlsstraße und Innenhof als Büffetzimmer genutzt. Unter der
Speisegalerie befand sich die Küche, weitere zugehörende Räume (Konditorei
etc.) lagen zu beiden Seiten der Durchfahrt unter dem Büffetzimmer. Die
Verbindung zum Obergeschoß stellte eine Treppe zwischen Speisegalerie, Unterer
Karlsstraße und Büffetzimmer her (auf der Photographie hinter der rechten Tür).

Der Pariser Saal, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 286)
Die Wände des Pariser Saals (Büffetzimmer)
waren bis zum Kämpfergesims mit Boiserie bekleidet: ebenso wie die Türen
hauptsächlich in verschiedenen Gelbtönen lackiert, mit vergoldeten Rahmen;
desgleichen waren die Ofennischen mit den seitlichen Pilastern aus gelblichem Stuckmarmor.
Die Wandfelder und Supraporten waren verspiegelt bzw. auf weißem Grund mit
pompejanischen Dekorationen und Bacchanalien bunt bemalt. Die Füllungen der
Türen und der Lambris waren in dunklerem Gelb lackiert. Die obere Wandzone
bestand aus rosagrauem Stuckmarmor, Flachreliefs, Hauptgesims und Archivolten
aus weißem Stuckmarmor. Die Decke mit blaugrünen Vouten und rosafarbenem Grund,
die Dekors in Bronze, Grün, Gelb und Blau gemalt. Die Flachreliefs stellten
über den Ofennischen Musik (N-Seite) und den Tanz (S-Seite) dar, über den Türen
gefesselte Kentauern mit Amoretten.
An den Roten Saal des Weißen Palais grenzten in östlicher Richtung
weitere Wohnräume an:

Grünes Wohnzimmer (Arbeitszimmer), 1910
(Holtmeyer,
Tafel 272)
Fries- und Deckenbemalung in bunten Farben
stammten aus einer Renovierung des Jahres 1845. Die Wände waren mit grünem
Damast bespannt. Lambris und Türen
bestanden aus dunkel gebeiztem Birkenholz, helleren Füllungen aus Birke und
Rahmen aus Kirschholz. Der Stuckmarmor an Säulen und Ofennische war grau, Basen
und Kapitelle sowie Profilleisten weiß.
In diesem Raum, der auch als Arbeitszimmer
Kurfürst Wilhelms II. diente, spielte sich am 15. September 1830 ein
bedeutendes Ereignis der hessischen Geschichte ab: Unter Führung des
Oberbürgermeisters Carl Schomburg überreichten der Kasseler Stadtrat und einige
Deputierte aus der Bürgerschaft dem Kurfürsten eine Petition. Darin schilderten
sie die Not des Landes und die Gefahren, die daraus resultieren könnten. Abschließend
baten sie um Einberufung der Ständeversammlung. Als der Kurfürst – sichtlich
gerührt – dem zustimmte, gab der Küfermeister und Likörfabrikant Carl Herbold
am Fenster ein Zeichen mit seinem Taschentuch; die wartende Volksmenge brach in
Jubel aus, und der Kurfürst zeigte sich auf dem Balkon des Palais. – Die
Bewilligung der Petition mündete schließlich in die Aufstellung und
Verabschiedung der Kurhessischen Verfassung 1831, die als freiheitlichste
innerhalb des Deutschen Bundes und sogar als fortschrittlichste im Europa jener
Zeit gilt.

Das Goldkabinett, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 282)
Dieser Raum befand sich bereits im Roten
Palais, zwischen Grünem Wohnzimmer und Thronsaal. Er entsprach in seiner
Ausstattung ganz den übrigen Wohnräumen des Weißen Palais: Lambris und Türen
aus Ahornholz, mit Füllungen aus Birkenmaser und Rahmen aus Birnbaum; aus
Birnbaumholz ebenfalls die Verdachungen über den Türen. Die Ofennische mit
grauem Stuckmarmor mit weißen Leisten bekleidet, die Wände mit weißer Tapete mit
Golddruck bespannt. Die Decke war bunt bemalt.

Das Schlafzimmer, 1910
(Holtmeyer,
Tafel 274)
Das Schlafzimmer mit dem benachbarten
Ankleidezimmer grenzte hofseitig an das Vorzimmer der Beletage im Weißen Palais
an; neben den verschiedenen Hölzern dominierten seit einer Renovierung von 1861
die Farben Grün und Weiß den Raum: Wandbespannungen aus grünem Seidendamast,
Decke und Fries weiß, mit aufgemalten grünen Ornamenten, in der Mitte eine
vergoldete Stuckrosette; Kapitelle und Basen der Säulen und Pilaster ebenfalls
weiß. Lambris, Türen, Säulen- und Pilasterschäfte sowie die Möbel aus
Birkenmaserholz; die Füllungen dunkel gebeizt, die Rahmen aus Nußbaumholz. An
den Möbeln außerdem Sockel aus Mahagoni und vergoldete Beschläge.

Schlafzimmer, Ruhebett
(Bidlingmaier,
S. 135)
Das Residenzpalais:
Weißes Palais, Rotes Palais und Palais Reichenbach
Rundgang
durch die Zeremonialräume des Roten Palais: Vestibül,
Haupttreppenhaus, Empfangsräume und Thronsaal
Geschichte
des Palais Reichenbach